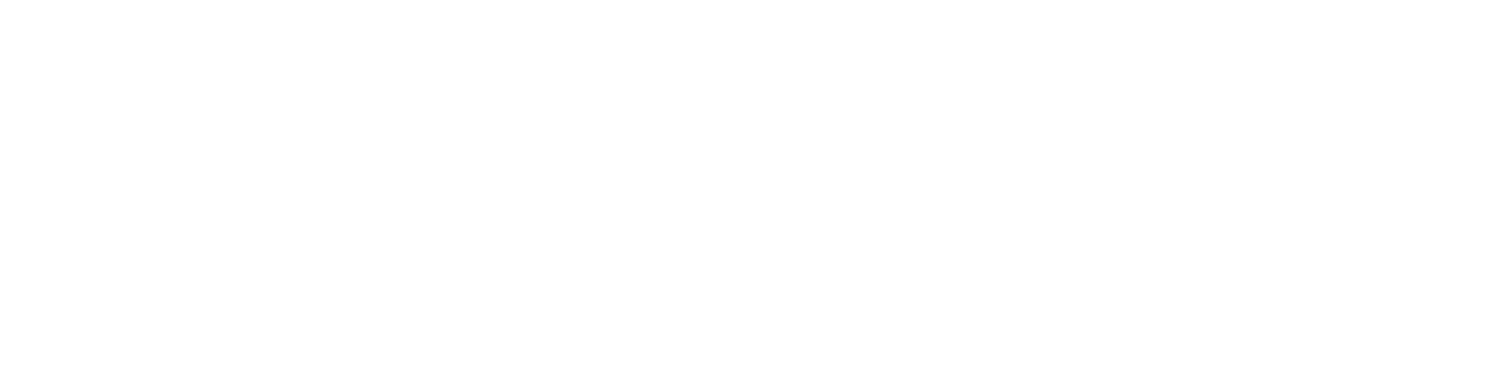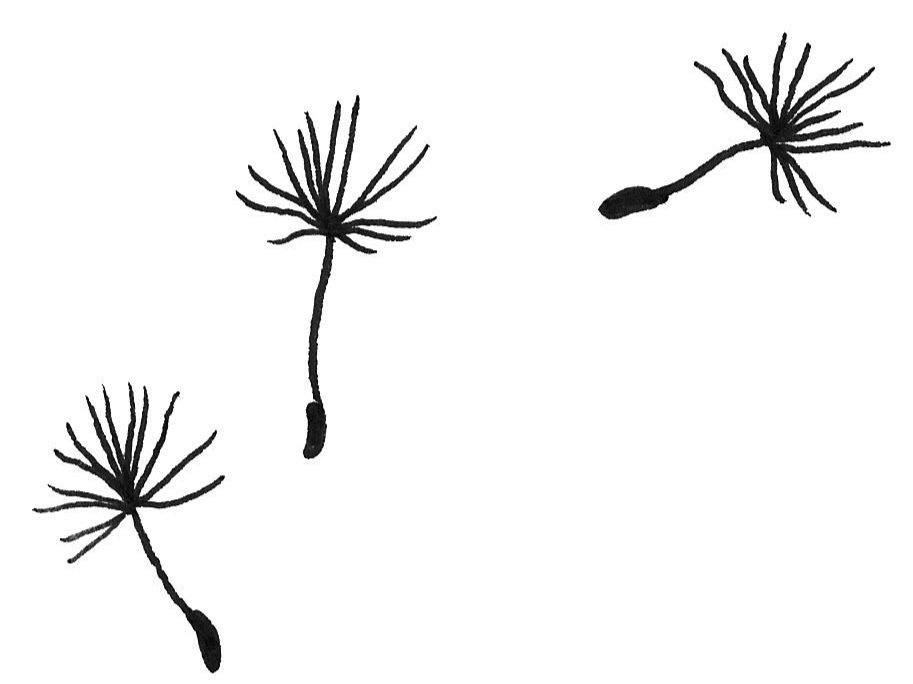Zucht und Vorurteil
Text: Nicole Häfliger, Illustrationen: Elisa Debora Hofmann
Die wundersame Vermehrung der Pflanzen
Bei der Fortpflanzung haben Pflanzen uns Menschen einiges voraus. Das beginnt bei der Auswahl an Befruchtungshilfsmitteln (nebst Bienen und anderen Geflügelten reicht zuweilen schon ein Windstoss), beeindruckt mit der Zahl möglicher Nachkommen (ein Löwenzahn produziert ca. 5000 Samen pro Jahr und treibt damit Golfrasenbesitzer in den gepflegten Wahnsinn) und punktet mit deren Haltbarkeit – einige Samen überdauern über 100 Jahre in der Erde. All das betrifft die generative Vermehrung, bei der eine weibliche Ei- und eine männliche Samenzelle mit jeweils unterschiedlicher DNA verschmelzen. Aber Pflanzen können noch mehr. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihren Zeigefinger abschneiden und in die Erde stecken. Oder Sie stünden relativ lange und an Ihren Füssen bildeten sich Ausläufer. In beiden Fällen entstünde eine genetisch exakte Kopie von Ihnen, ein Klon also. Diese eine Art der ungeschlechtlichen Vermehrung, nämlich über Pflanzenteile, nennt man vegetativ. Den Vogel schiessen aber Pflanzen ab, die Samen bilden können, ohne befruchtet zu werden – apomiktisch nennt man diese andere ungeschlechtliche Vermehrung. Beispiele dafür sind Löwenzahn, Zitrusgewächse oder Brombeeren. Bei all dem haben wir Menschen den Pflanzen aber eines voraus: Wir können sie ganz gezielt vermehren.
Nicht immer besser: alte Sorten
«Wissen Sie, ich ziehe nur noch richtig alte Gemüsesorten, die sind besser. Wie diese blauen St. Galler Kartoffeln», erzählte mir eine Frau und brachte mich zum Grübeln. Warum gehen wir davon aus, alte Sorten seien per se besser? Überhaupt, was heisst hier «alt»? Eine offizielle Definition gibt es nicht, doch landläufig gilt als alt, was vor den letzten 30 Jahren gezüchtet worden ist, während alles vor 1920 als historisch oder «Landsorte» bezeichnet wird. Land bzw. Familiensorten entstanden durch mehr oder weniger gezielte Auslese über Generationen hinweg und kennzeichnen sich durch ihre genetische Vielfalt. Baut man sie an, sind Grösse, Geschmack und Ertrag selten einheitlich. Das müssen sie auch nicht. Sie sind darauf ausgerichtet, sich ständig zu verändern und weiterzuentwickeln. Beides aber macht sie nur für Privatgärten oder den Anbau in kleinem Stil geeignet. Als Lokalsorten sind sie überdies meist abhängig von den jeweilig lokalen Bedingungen: Sie kommen nicht mit jedem Klima und Boden zu recht und sind bisweilen sogar erstaunlich krank heitsanfällig (z. B. weil sie diesen Krankheiten nie ausgesetzt waren). Ausserdem züchtete man entgegen häufiger Behauptung auch früher schon auf Ertrag und Haltbarkeit – auch wenn dies auf Kosten des Geschmacks ging. Dass es heute nicht mehr jede Landsorte gibt, hat mitunter also auch seine guten Gründe.
Blaue St. Galler
Von Christoph Gämperli gezüchtete und seit 2006 zugelassene (also neue) Kartoffelsorte mit kochfester blau-violetter Farbe.
Nicht immer schlechter: Neuzüchtungen
Mit dem Aufkommen der Industrialisierung und Globalisierung veränderten sich auch die Ansprüche. Die Nachfrage nach Sorten mit erwartbaren Eigenschaften (Ertrag, Reifezeit, Grösse, Geschmack) und guter Transportfähigkeit verdrängte die meisten Lokalsorten, was zu einer eklatanten Sortenarmut führte. Zudem konnte dank der Möglichkeit, billig Kunstdünger und Pestizide herzustellen, die Widerstandsfähigkeit bei Neuzüchtungen vernachlässigt werden (siehe unten). Doch seitdem hat sich einiges verändert. In der modernen Zuchtarbeit (auch im Zierpflanzenbereich) liegt der Fokus immer mehr auf «ökologischen», sprich krankheitsresistenten Sorten. Verändert haben sich auch die Ansprüche der Konsumenten und Konsumentinnen: Gefragt ist eine möglichst grosse Sortenvielfalt mit jeweils einheitlichen, erwartbaren Eigenschaften wie «einfach zu verarbeiten» und «lecker im Geschmack».
Gala
Die altbekannte und bis heute beliebteste Apfelsorte der Schweiz wurde 1965 gezüchtet. Sie ist so anfällig auf Krankheiten, dass sie selbst als Bio-Apfel mehrmals gespritzt werden muss.
Definitiv nicht böse: F1-Hybriden
Der technische Name erinnert an etwas im Labor Erschaffenes. Vielleicht werden F1-Hybriden darum mit Gentechnologie und bösen Machenschaften gleichgesetzt. Für Letztere können sie zwar prima benutzt werden, doch der 1864 von Mendel eingeführte Begriff bezeichnet etwas komplett Unschuldig-Natürliches:
F1-Hybriden sind Individuen
der ersten Filial-, also Tochtergeneration (F1)
zweier sich verkreuzter Arten
bzw. Sorten (Hybriden).
Um sie gezielt zu züchten, braucht man zwei möglichst unterschiedliche Sorten, mit denen über mindestens 7 Generationen Inzucht betrieben wird, damit sie garantiert samenfest («rassenrein») sind. Kreuzt man dann diese zwei Linien, ergibt sich der Heterosis-Effekt: einheitliche Individuen, mehr Ertrag, grössere Früchte, stärkere Wüchsigkeit, bessere Vitalität und ausgeprägtere Resistenzen. Dieser Effekt zeigt sich aber nur in der ersten Generation. Sät man F1-Samen aus, kriegt man nicht mehr dieselben, sondern ganz unterschiedliche Individuen. F1-Hybriden sind also nicht samenecht und somit für rein profitorientierte Saatgutkonzerne höchst attraktiv, da man sie nicht nachziehen kann. Nichtsdestotrotz können auch aus F1-Hybriden samenfeste Sorten entstehen, und zwar mittels altmodischer Auslese. Ein schönes Beispiel hierfür ist die von einem deutschen Demetergärtner gezüchtete samenfeste Zuckermaissorte Dolcina.
Auch das sind F1-Hybriden:
Viele Apfelsorten wie Adersleber Kalvill von 1839 und Golden Delicious von 1900.
Unsere Kulturerdbeeren stammen aus einer 1750 entstandenen Kreuzung der Chilenischen Erdbeere (Fragaria chiloensis) und der Nordamerikanischen Scharlacherdbeere (F. virginiana).
Die zu Recht beliebten Flower Sprouts (= Kalettes) sind als Kreuzung aus Rosen- und Grünkohl gezüchtet worden und seit 2010 auf dem Markt.
Mendel wusste es besser
Dieses Jahr würde er 200: Gregor Johann Mendel, der Vater der Genetik. Ihm haben wir nicht nur den Begriff F1-Hybride zu verdanken, sondern auch die drei berühmten Mendelschen Vererbungsregeln. Wurde vor Mendel nach rein äusserlichen Kriterien ausgelesen, konnte man dank ihm nun systematisch züchten und tat das auch höchst leidenschaftlich. Das Resultat ist eine beeindruckende Fülle und Vielfalt an damals neu gezüchteten Sorten. Während es heute schick ist, wissenschaftlichen Erkenntnissen grundsätzlich mit Misstrauen und Argwohn zu begegnen, haben wir ihnen mehr zu verdanken, als wir manchmal ahnen.
Am besten selber machen?
Im Hobbygarten Gemüse aus selbstgewonnenen Samen zu ziehen, macht Spass und scheint auch kinderleicht. Jedenfalls auf den ersten Blick. Bei den «einfachen» Selbstbefruchtern (wie Tomate, Erbse, Salat) sollte immerhin darauf geachtet werden, dass sie sich nicht doch mit anderen Sorten verkreuzen, und es sollten immer mehrere Pflanzen zur Auswahl stehen, damit auf die Besten, Grössten, Leckersten… ausgelesen werden kann. Bei den Fremdbefruchtern (wie Rüebli, Spinat, Kohl) braucht es immer mal wieder «neues Blut», um Inzucht zu vermeiden. Und von gewissen Gemüsen sollte man ganz die Hände lassen, wenn man sich nicht ernsthaft vergiften möchte. Zieht man Zucchetti oder Kürbis nach und wächst im eigenen oder in Nachbars Garten Zierkürbis, können aus der ungewollten Verkreuzung Nachfahren entstehen, die das giftige Cucurbitacin enthalten. Selber machen ist toll. Ebenso toll ist es, hin und wieder auch die wertvolle Arbeit professioneller Bio-Saatguthersteller in der Schweiz zu unterstützen.
Rapsöl
Aufgrund seines schlechten Geschmacks wurde Rapsöl nur für Öllampen eingesetzt. Erst 1974 gelang es, die eklige Erucasäure durch wertvolle Ölsäure zu ersetzen. So wurde der Raps zum Lieferanten für unser heute wichtigstes heimisches Speiseöl.